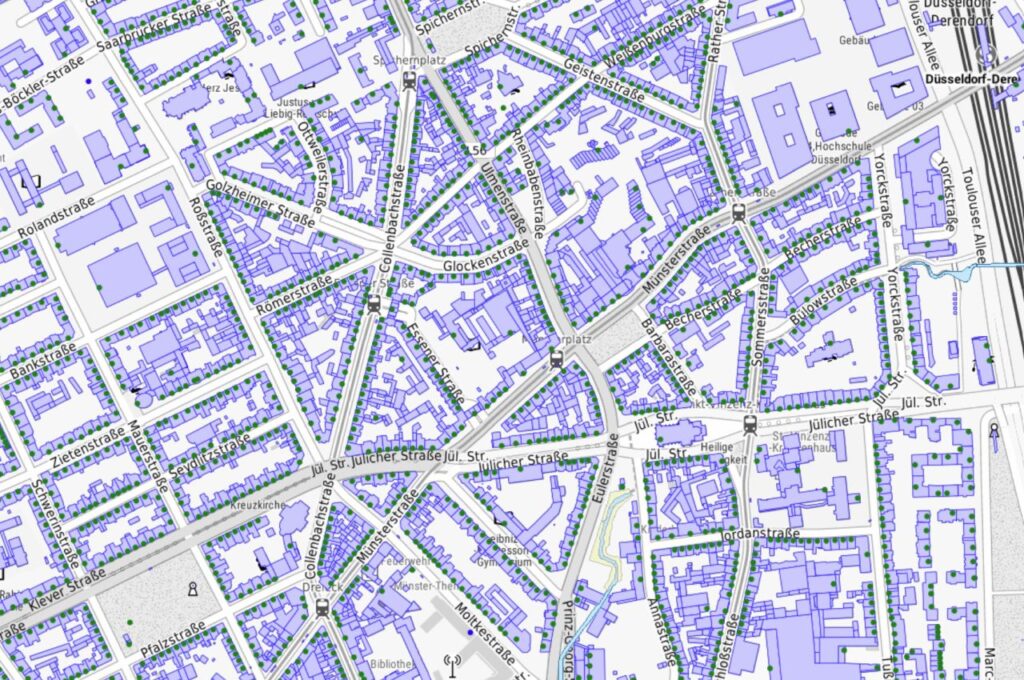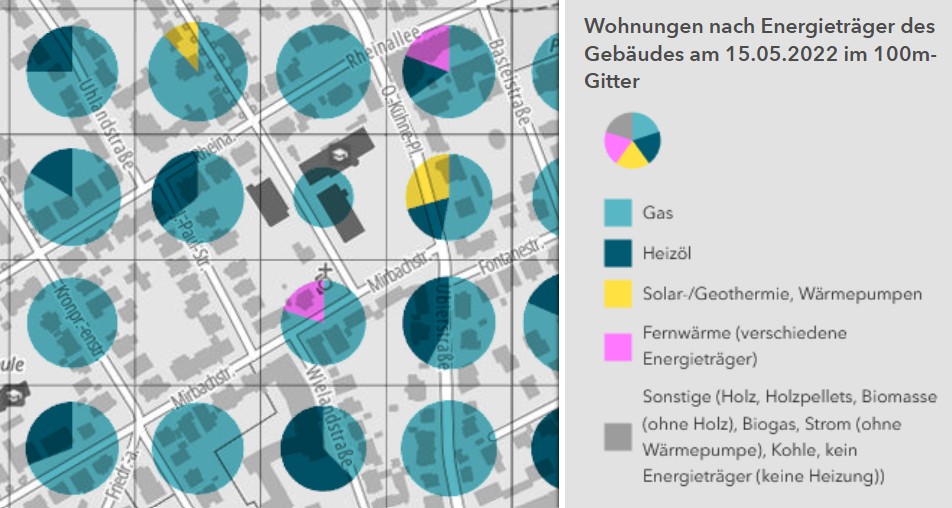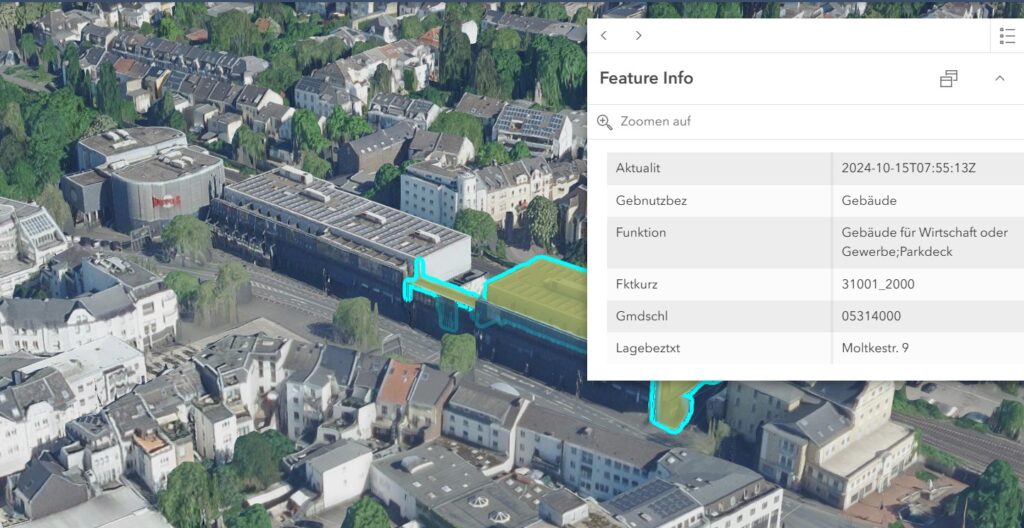3. November 2025. Wer die Gesundheitswende beleuchten will, tut gut daran, die stetig wachsende Zahl der Medizinischen Versorgungszentren, kurz MVZ, in ihren Gesellschafterstrukturen transparent zu machen. Dies ermöglicht nun der neue MVZ-Monitor des data analytics institute (dai).
MVZ-Monitor offenbart maximale Transparenz bei Inhabern
Auf die mehr als 5.000 Medizinischen Versorgungszentren kommen im Schnitt 6,3 Ärzte, in Summe sind das 31.872 (mit Stand 31.12.2024, siehe Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung). Durch eine einzigartige Kombination unterschiedlicher Datenbanken, kann der MVZ-Monitor auf
- die Rechtsform des jeweiligen MVZ
- alle bekannten Ärzte je MVZ
- den/die geschäftsführenden Arzt/Ärztinnen
- die Gesellschafteranteile und -verpflechtungen
zurückgreifen. Dies ermöglicht maximale Transparenz in den Inhaber-Strukturen und offenbart fachfremde Investoren.
Doch nicht nur das! Auch Neugründungen und Veränderungen der Gesellschafterstrukturen je Monat oder Quartal werden beobachtet. Dies erlaubt ein detailliertes Monitoring der Beteiligungsentwicklung je Gesellschaft.
TWIN-Datenmodell und daia-x machen es möglich
Das TWIN-Datenmodell der dai ermöglicht es, unterschiedliche Datenbanken miteinander zu kombinieren und harmonisieren. Verknüpft werden so über 31.000 Arztadressen mit allen MVZ sowie den Handelsregisterinformationen.
Sowohl das komplette Handelsregister- als auch die Ärztedatenbank (Quelle: ArztData AG) sind Teil der neuen daia-x Plattform.
Selbständig oder angestellt im MVZ?
Niedergelassene Ärzte sind selbständig alleine oder im Verbund tätig. Neben der Einzelpraxis existieren des Weiteren die Zweigpraxis sowie Gemeinschaftsformen, z.B. Gemeinschaftspraxen, Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) und MVZ. Ein Arzt kann demnach mehreren Arztpraxen haben ggf. mit zusätzlich angestellten Ärzten (eher selten). Hier greift eher eine Gemeinschaftsform als juristische Person (zB GmbH), mit angestellten Ärzten, die aber durchaus als selbständig gelten können.
Komplexes Beispiel einer MVZ-Neugründung aus der Praxis
Dr. F. Müller, Dr. S. Müller sowie Dr. C. Meier sind im MVZ Müller & Kollegen GmbH in Bonn (HRB 265xx) angestellt. Gründung 2021. Dr. F. Müller ist seitdem einer von zwei eingetragenen Geschäftsführern. Besitz- (Gesellschafteranteile) oder Einflussverhältnisse bei der GmbH können dabei so liegen, dass die „angestellten“ Geschäftsführer als geschäftsführende Gesellschafter agieren und damit auch als selbständig gelten können. Angestellt sein bedeutet demnach, die GmbH gehört voll (oder zum größten Teil) einem Dritten: In diesem Echtfall (nur Namen geändert) einer privaten Klinik GmbH in Bad Münster, die wiederum einer GmbH in Hamburg gehört.
Handelsregisterdatenbank mit allen Verpflechtungen
Das data analytics institute hat Zugriff auf alle Handelsregisterdaten, aktuell wie historisch, und verknüpft diese mit allen Ärztedaten. Dies ermöglicht eine maximale Transparenz in den Eigentumsverhältnissen und gibt Aufschluss darüber, ob und welche Art von Investoren hinter einem MVZ stehen.
Kontakt
Sie haben Fragen zum MVZ-Monitor? presse@dai.institute
Bei uns erhalten Sie auf Wunsch auch kostenlos das MVZ-Neugründungsbeispiel mit allen zugehörigen Detail- und Tiefeninformationen.