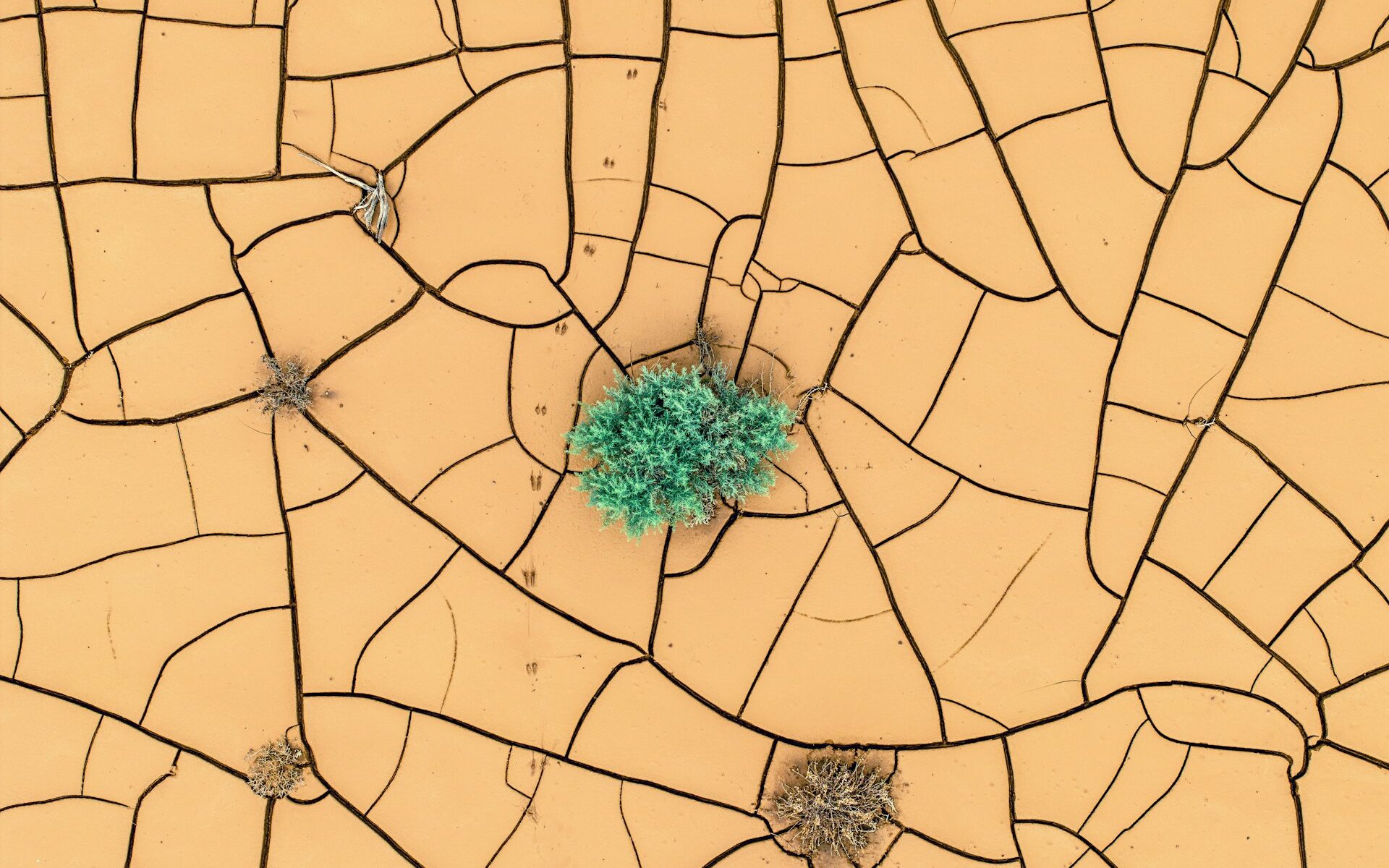Neues Konsortium aus drei Spezialisten der Datenwirtschaft führt zur einzigartigen Datenbank für Gebäudedaten. Der Nutzen ist sektorübergreifend groß. So liegt nun beispielsweise der Energiewärmebedarf je Haushalt für über 23,3 Millionen Gebäude adressgenau vor. Denn der strategische Datenzusammenschluss erfolgt erstmals mit der Deutschen Post Direkt und ihrer postalisch hochaktuellen Gebäudebasisdatenbank microdialog, Spezialdaten für Energie von ENEKA sowie nicht zuletzt die damit kombinierten und disaggregierten Zensusdaten des data analytics instituts (dai).
Postalische Gebäudebasisdaten
Bereits seit vielen Jahren verlässt sich die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV) bei ihren deutschlandweiten, hochpräzisen 3D-Gebäudedaten auf die postalische Grundsubstanz und Kompetenz der Deutschen Post. Bisher ungenutzt blieben dabei sozi-ökonomische Daten der microdialog wie beispielsweise Haushalte und gewerbliche Informationen, die Aufschluss über Nutzung im Gebäude je Adresse liefern. Der Datenkatalog dazu ist über die dai ab sofort erhältlich.
Amtliche Gebäudebasisdaten
Aus den amtlichen 3D-Gebäudedaten in Kombination mit den Adressen lassen sich neben Lage und Gebäudeform hochpräsize Informationen ableiten wie z.B.
- Gebäudegrundfläche
- Gebäudevolumen
- Gebäudehöhen nach Trauf und First
- Gebäudegeschosse
- Gebäudedachform
- Gebäudefunktion
- Gebäudeausrichtung
- Gebäudedachfläche
- Gebäudefassadenfläche
Energiedaten pro Gebäude
Durch die Kombination der amtlichen Gebäudedaten mit den weiterführenden sozio-ökonomischen Informationen lassen sich spezifische Energiedaten je postalischer Adresse berechnen wie beispielsweise der Raumwärmebedarf, der durch Bilanzierung von Kennwerten entsteht und zwar auf Basis der Gebäudespezifika, die sich typologisch durch die Auswertung von Gebäudetyp, -nutzung, Baujahr und Kubatur ergeben. Darauf ausgerichtet hat sich der Energiedatenspezialist ENEKA, neben Deutscher Post Direkt und dai der Dritte im Bunde.
Zensusdaten
Komplettiert wird die Erstversion der Datenbank durch die weitere Kombination mit den Zensusdaten 2022. So entsteht eine einzigartige Datenvielfalt aus Private & Public Data. Eines der wichtigsten Merkmale – ob für strategische Planungen oder operative Maßnahmen – ist die (geschätzte) Anzahl der Einwohner pro Gebäude. Das data analytics institute hat für diese Fragestellung das Projekt „INHABITAT“ mit der Wissenschaft aufgesetzt.
TWIN – Die Datenbank für die Datenwirtschaft
Die Gebäudedaten sind Bestandteil der (verteilten) Datenbank TWIN. Sie hat zum Ziel, ein möglichst reales, digitales Abbild von Mensch & Raum widerzugeben. Grundgedanke dabei ist, dass die (private & öffentliche) Datenwirtschaft ihre Datensilos bereitstellt und teilt, damit sie fragestellungsbezogen miteinander verknüpft werden können. Der Gedanke folgt der EU-weiten Datenstrategie, so die Datenökonomie zu fördern und zu stärken. Das data analytics institute versteht sich hier als Intermediate – so, dass die Datenbank fortlaufend wächst durch verschiedenste Datenquellen und deren Kombinationen untereinander.
TWIN.Building.Geo als Open Data Initiative
Wichtig zu wissen: Es gibt die amtlichen Geobasisdaten der Gebäude in 3D, dazu die Adressen mit postalischer Anschrift und Lage als Open Data aus einem Guss (vollständiger Datensatz der 16 Länder) an unserem Institut, den wir auf Anfrage gerne bereitstellen.
Kontakt
Sie interessieren sich für unseren Datenkatalog oder weiterführende Informationen? Dann kontaktieren Sie uns ganz einfach unter presse@dai.institute